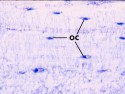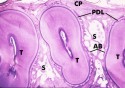
Abb. 116: Parallel zur Okklusionsebene verlaufender
Querschnitt durch die Oberkieferprämolarenregion. Erkennbar ist der eigentliche
Alveolarknochen (AB), der als eine kontinuierliche dünne Platte kompakten
Knochens jeden Zahn umgibt und von den Knochenbälkchen des benachbarten
spongiösen Knochens (S) gestützt wird. Der eigentliche Alveolarknochen
verschmilzt mit der kortikalen Platte (CP) des Alveolarfortsatzes und lässt sich
von dieser nicht mehr abgrenzen. Das Desmodont verankert den Zahn (T) am
Alveolarknochen.
 Abb. 117:
Vergrößerte Ansicht der Abb. 116. Beachten Sie die Knochenbälkchen (BT), mit deren Hilfe die
dünne Alveolarknochenschicht (AB) gestützt wird. Die histologische Struktur des Alveolarknochens spiegelt die Remodellierung wider, die im Zusammenhang
mit der Mesialdrift der Zähne stattfindet. Während der normalen Funktion erleiden die Zähne approximal einen Substanzverlust. Um jedoch die engen interdentalen
Kontakte weiterhin aufrechtzuerhalten, neigen die Zähne dazu, sich in mesiale Richtung durch den Knochen zu bewegen.
Dies bedeutet, dass der mesial von einem Zahn befindliche Knochen resorbiert werden muss, um dem Zahn die
Bewegung zu ermöglichen. An dem Knochen, der sich distal des Zahnes befindet, wird dagegen neuer Knochen angelagert,
um die Breite des Desmodontalspalts konstant zu halten. In diesem Schnitt ist mesial links.
Abb. 117:
Vergrößerte Ansicht der Abb. 116. Beachten Sie die Knochenbälkchen (BT), mit deren Hilfe die
dünne Alveolarknochenschicht (AB) gestützt wird. Die histologische Struktur des Alveolarknochens spiegelt die Remodellierung wider, die im Zusammenhang
mit der Mesialdrift der Zähne stattfindet. Während der normalen Funktion erleiden die Zähne approximal einen Substanzverlust. Um jedoch die engen interdentalen
Kontakte weiterhin aufrechtzuerhalten, neigen die Zähne dazu, sich in mesiale Richtung durch den Knochen zu bewegen.
Dies bedeutet, dass der mesial von einem Zahn befindliche Knochen resorbiert werden muss, um dem Zahn die
Bewegung zu ermöglichen. An dem Knochen, der sich distal des Zahnes befindet, wird dagegen neuer Knochen angelagert,
um die Breite des Desmodontalspalts konstant zu halten. In diesem Schnitt ist mesial links.
 Abb. 118:
Periapikales Röntgenbild einer Unterkieferseitenzahnregion. Das Röntgenbild ist die
summierte Darstellung aller zwischen der Strahlenquelle und dem Film befindlichen Strukturen.
Dichte Strukturen wie Zähne und Knochen erscheinen hell, wohingegen
nichtmineralisierte Gewebe dunkel imponieren. Die im Röntgenbild sichtbare
dünne, weiße Linie, die parallel zum Umriss der Zahnwurzeln verläuft, entspricht
dem eigentlichen Alveolarknochen. Der Terminus für diese im Röntgenbild sichtbare
Linie ist Lamina dura (LD). Der Desmodontalspalt (PDL) imponiert
als dunkle Linie zwischen der Lamina dura und der Wurzeloberfläche. Das
trabekuläre Muster des spongiösen Knochens (S) kann ebenfalls leicht erkannt
werden.
Abb. 118:
Periapikales Röntgenbild einer Unterkieferseitenzahnregion. Das Röntgenbild ist die
summierte Darstellung aller zwischen der Strahlenquelle und dem Film befindlichen Strukturen.
Dichte Strukturen wie Zähne und Knochen erscheinen hell, wohingegen
nichtmineralisierte Gewebe dunkel imponieren. Die im Röntgenbild sichtbare
dünne, weiße Linie, die parallel zum Umriss der Zahnwurzeln verläuft, entspricht
dem eigentlichen Alveolarknochen. Der Terminus für diese im Röntgenbild sichtbare
Linie ist Lamina dura (LD). Der Desmodontalspalt (PDL) imponiert
als dunkle Linie zwischen der Lamina dura und der Wurzeloberfläche. Das
trabekuläre Muster des spongiösen Knochens (S) kann ebenfalls leicht erkannt
werden.
 Abb.
119 (Lindhe, J., 1983):
Knochen wird gebildet von Osteoblasten (OB), die im Periost, Endost und
Desmodont an Knochenbildungsoberflächen gefunden werden. Diese
spezialisierten Zellen stammen von weniger differenzierten Vorläuferzellen in der Nähe des Knochens ab.
Diese Zellen wiederum sind aus undifferenzierten ektomesenchymalen Zellen des Periosts,
Endosts und Desmodonts entstanden. Während der Knochenbildung werden Osteoblasten vollständig in Knochen
eingeschlossen und zu Osteozyten (OC) umgewandelt. Die Kammer, in der die Osteozyten gefangen sind, wird Lakune (= lacuna,
plur. lacunae) genannt. Über zytoplasmatische Fortsätze, die
durch schmale Knochenkanälchen oder canaliculi (C)
verlaufen, bleiben Osteozyten mit Osteoblasten und anderen Osteozyten verbunden (siehe Abb. 120).
Abb.
119 (Lindhe, J., 1983):
Knochen wird gebildet von Osteoblasten (OB), die im Periost, Endost und
Desmodont an Knochenbildungsoberflächen gefunden werden. Diese
spezialisierten Zellen stammen von weniger differenzierten Vorläuferzellen in der Nähe des Knochens ab.
Diese Zellen wiederum sind aus undifferenzierten ektomesenchymalen Zellen des Periosts,
Endosts und Desmodonts entstanden. Während der Knochenbildung werden Osteoblasten vollständig in Knochen
eingeschlossen und zu Osteozyten (OC) umgewandelt. Die Kammer, in der die Osteozyten gefangen sind, wird Lakune (= lacuna,
plur. lacunae) genannt. Über zytoplasmatische Fortsätze, die
durch schmale Knochenkanälchen oder canaliculi (C)
verlaufen, bleiben Osteozyten mit Osteoblasten und anderen Osteozyten verbunden (siehe Abb. 120).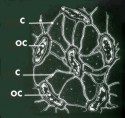
Abb. 120 (Lindhe, J., 1983): Schematische Darstellung
von Knochenkanälchen (C), die benachbarte, in ihren Lakunen befindliche Osteozyten
(OC) miteinander verbinden
Abb. 121: Histologischer Schnitt durch kompakten Knochen. Die in ihren Lakunen
befindlichen Osteozyten (OC) sind über das gesamte Gewebe verteilt. In gefärbten
Schnitten wie diesem ist das dichte Netz von Knochenkanälchen, die benachbarte Lakunen miteinander verbinden, leicht
erkennbar.
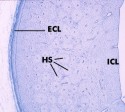 Abb. 122: Kortikale
Platte kompakten Knochens im Unterkiefer. Der Unterkiefer
ist von einer gut entwickelten Rinde kompakten Knochens umgeben. Der Hauptanteil des kompakten Knochens
besteht aus konzentrisch aufgebauten Knocheneinheiten, den Osteonen oder Haversschen
Systemen (HS). Jedes Osteon besitzt einen
zentralen Kanal, den Haversschen Kanal, der ein Blutgefäß beherbergt. Haverssche Kanäle sind miteinander und
der Rindenperipherie über Volkmannsche Kanäle, die senkrecht zu den Haversschen Kanälen verlaufen, verbunden. Die
äußeren und inneren Rindenschichten bestehen aus parallel verlaufenden Lamellen kompakten Knochens,
den äußeren (ECL) und den inneren Grundlamellen.
Der die Räume zwischen benachbarten Osteonen ausfüllende Knochen wird als
interstitieller Knochen bezeichnet.
Abb. 122: Kortikale
Platte kompakten Knochens im Unterkiefer. Der Unterkiefer
ist von einer gut entwickelten Rinde kompakten Knochens umgeben. Der Hauptanteil des kompakten Knochens
besteht aus konzentrisch aufgebauten Knocheneinheiten, den Osteonen oder Haversschen
Systemen (HS). Jedes Osteon besitzt einen
zentralen Kanal, den Haversschen Kanal, der ein Blutgefäß beherbergt. Haverssche Kanäle sind miteinander und
der Rindenperipherie über Volkmannsche Kanäle, die senkrecht zu den Haversschen Kanälen verlaufen, verbunden. Die
äußeren und inneren Rindenschichten bestehen aus parallel verlaufenden Lamellen kompakten Knochens,
den äußeren (ECL) und den inneren Grundlamellen.
Der die Räume zwischen benachbarten Osteonen ausfüllende Knochen wird als
interstitieller Knochen bezeichnet.

Abb. 123: Schnitt durch die äußeren Grundlamellen (ECL) und das Periost (P) einer Unterkieferrinde. Die kortikale Platte
unterliegt einer ständigen Remodellierung. Dunkelblau gefärbte Osteone (HS1) mit weiten Haversschen Kanälen
sind relativ jung, wohingegen die rosafarbenen Osteone (HS2) mit kleinen Haversschen Kanälen
reifer sind. Interstitieller Knochen (IB) füllt die Räume zwischen den Osteonen aus.