Zum gingivalen Epithel gehören das epitheliale Gewebe, das die Außenfläche der Gingiva überdeckt, das Epithel, das den gingivalen Sulkus auskleidet, sowie das Saumepithel (Abb. 9).
 Abb. 9: (Schnitt mit freundlicher Genehmigung von Dr. H. E. Schroeder): Das gingivale
Epithel besteht aus 3 Anteilen: dem oralen
Gingivaepithel (OE), dem oralen
Sulkusepithel (SE) und dem Saumepithel (JE). Das
orale Gingivaepithel erstreckt sich von der mukogingivalen Grenzlinie bis zum
Zahnfleischrand. Es geht fließend in das orale Sulkusepithel über, das die
Seitenwand des gingivalen Sulkus auskleidet. Das Saumepithel bildet die
dentoepitheliale Verbindung apikal des Sulkus. Das koronale Ende des
Saumepithels bildet den Boden des gingivalen Sulkus und wird vom oralen
Sulkusepithel überlappt. Diese Epithelien unterscheiden sich voneinander in
ihrer Funktion und daher in einigen histologischen Merkmalen.
Abb. 9: (Schnitt mit freundlicher Genehmigung von Dr. H. E. Schroeder): Das gingivale
Epithel besteht aus 3 Anteilen: dem oralen
Gingivaepithel (OE), dem oralen
Sulkusepithel (SE) und dem Saumepithel (JE). Das
orale Gingivaepithel erstreckt sich von der mukogingivalen Grenzlinie bis zum
Zahnfleischrand. Es geht fließend in das orale Sulkusepithel über, das die
Seitenwand des gingivalen Sulkus auskleidet. Das Saumepithel bildet die
dentoepitheliale Verbindung apikal des Sulkus. Das koronale Ende des
Saumepithels bildet den Boden des gingivalen Sulkus und wird vom oralen
Sulkusepithel überlappt. Diese Epithelien unterscheiden sich voneinander in
ihrer Funktion und daher in einigen histologischen Merkmalen.
Es ist das mehrschichtige, schuppenartige keratinisierende Epithel, das die Gingiva vestibulär und
oral überzieht. Es erstreckt sich vom Zahnfleischrand bis zur mukogingivalen Grenzlinie (siehe Abb. 1).
Nur auf der palatinalen Seite geht es ohne eine deutliche Begrenzung in das
palatinale Epithel über (siehe Abb. 7).

Abb. 10: Das orale Gingivaepithel besteht aus einer Basalschicht (Stratum basale, SB), einer Stachelzellschicht (Stratum
spinosum, SS), einer Körnerschicht (Stratum granulosum, SG) und einer Hornschicht (Stratum
corneum, SC). Das orale Gingivaepithel dient vor allem dem Schutz
vor einer mechanischen Verletzung bei der Mastikation. Die Widerstandsfähigkeit gegen eine mechanische
Verletzung wird primär vermittelt durch die zahlreichen interzellulären Verbindungen, hauptsächlich Desmosomen,
die die Zellen fest zusammenhalten, und durch die Hornschicht. Die
Hornschicht und die relativ schmalen Interzellularspalten tragen
auch zu der vergleichsweise sehr geringen Permeabilität bei.
 Abb. 11 (Karring, T. and Löe,
H., 1970): Das orale Gingivaepithel ist mit dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina propria durch eine unregelmäßige Grenzfläche verbunden. Diese Grenzfläche besteht aus
fingerartigen bindegewebigen Vorsprüngen der papillären Schicht (Pfeile, Abb. 11 A), die in Vertiefungen der Basalfläche des
Epithels hineinreichen. Diese Vertiefungen (Abb. 11 B) befinden sich zwischen den sich kreuzenden leistenartigen Epithelwällen, die die Basalfläche des Epithels bilden. Querschnitte
dieser leistenartigen Epithelwälle in histologischen Schnitten werden manchmal Rete pegs genannt.
Abb. 11 (Karring, T. and Löe,
H., 1970): Das orale Gingivaepithel ist mit dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina propria durch eine unregelmäßige Grenzfläche verbunden. Diese Grenzfläche besteht aus
fingerartigen bindegewebigen Vorsprüngen der papillären Schicht (Pfeile, Abb. 11 A), die in Vertiefungen der Basalfläche des
Epithels hineinreichen. Diese Vertiefungen (Abb. 11 B) befinden sich zwischen den sich kreuzenden leistenartigen Epithelwällen, die die Basalfläche des Epithels bilden. Querschnitte
dieser leistenartigen Epithelwälle in histologischen Schnitten werden manchmal Rete pegs genannt.
Abb. 12: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung der Verbindung
zwischen einer Basalzelle des oralen Gingivaepithels und dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina
propria. 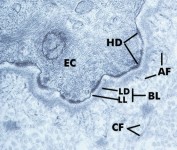 Die Epithelzelle (EC) enthält weithin verstreut zytoplasmatische Filamente, die auch Tonofilamente genannt
werden.
Die Epithelzelle (EC) enthält weithin verstreut zytoplasmatische Filamente, die auch Tonofilamente genannt
werden.
Die Epithelzellmembran, die sich gegenüber der Lamina propria befindet, ist mit zahlreichen Hemidesmosomen (HD) übersät und mit der Lamina propria durch eine Basallamina (BL) verbunden. Die Basallamina setzt sich zusammen aus einer elektronendichten Schicht, der Lamina densa (LD), und einer elektronendurchlässigen Schicht, der Lamina lucida (LL). Die Lamina densa besteht aus einem afibrillären Kollagen, dem Kollagen Typ IV. Die Lamina lucida setzt sich aus Laminin und anderen Glykoproteinen zusammen. Ankerfibrillen (AF), die
aus Kollagen Typ VII bestehen, erstrecken sich von der Unterseite der Lamina
densa in die Lamina propria hinein.