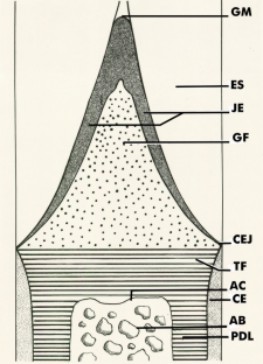Es ist das geschichtete, nichtkeratinisierende Epithel, das den Zahn wie ein Kragen ringförmig umgibt und im Querschnitt einem dünnen Keil ähnelt ( Abb. 1 und Abb. 9). Es ist auf der einen Seite großflächig mit dem Zahn und auf der anderen Seite großflächig mit dem gingivalen Bindegewebe verbunden. Das Saumepithel verfügt über zwei Basallaminae, wobei die eine Basallamina dem Zahn anliegt (interne Basallamina) und die andere ans Bindegewebe grenzt (externe Basallamina). Die proliferative Zellschicht, die für die meisten Zellteilungen verantwortlich ist, befindet sich in Kontakt mit dem Bindegewebe, d.h. neben der externen Basallamina. Die desquamative (abschilfernde) Schicht des Saumepithels befindet sich an seiner koronalen Begrenzung und bildet zugleich den Boden des gingivalen Sulkus.
Das Saumepithel ist permeabler als das orale Gingiva- und Sulkusepithel. Das Saumepithel dient als bevorzugter Weg für die Passage von bakteriellen Produkten aus dem Sulkus ins Bindegewebe und für die Durchtritt von Flüssigkeiten und Zellen aus dem Bindegewebe in den Sulkus.
Der Begriff epitheliales Attachment bezieht sich auf den Befestigungsapparat, d.h. die interne Basallamina und Hemidesmosomen, die das Saumepithel mit der Zahnoberfläche verbinden. Dieser Begriff ist kein Synonym für den Begriff Saumepithel, der sich auf das gesamte Epithel bezieht.
Abb. 20: Teil des Saumepithels (JE) in einem Bereich
direkt apikal des gingivalen Sulkus. Die Breite des Saumepithels kann von 30
Zellen in der Sulkusregion bis zu einer Zelle im am weitesten apikal gelegenen
Anteil reichen. Die Interzellularspalten zwischen den Saumepithelzellen sind
weiter als jene im oralen Gingiva- und Sulkusepithel. Das liegt teilweise an
der geringeren Dichte der Interzellularbrücken zwischen den
Saumepithelzellen. Verglichen mit dem oralen Gingiva- und Sulkusepithel,
beträgt die Dichte der Interzellularbrücken nur ungefähr ein Drittel.
Dieser Gewebeschnitt ist ungewöhnlich, da hier Entzündungszellen im subepithelialen Bindegewebe fehlen.

Abb. 21: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung
eines normalen, nichtentzündeten Saumepithels (JE). Die Zellen sind mit ihrer Längsachse parallel zur Zahnoberfläche
angeordnet. Die Interzellularspalten sind relativ schmal. Das Epithel ist mit dem Zahn
über die interne Basallamina (IBL) und mit
dem Bindegewebe (CT) über die externe
Basallamina (EBL) verankert. ES, Schmelzraum
Das Zytoplasma des Saumepithels enthält verstreut
Tonofilamente, aber keine Tonofibrillen. Unter normalen Umständen
keratinisieren diese Zellen nicht.
Abb. 22: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung des Saumepithels bei entzündeter Gingiva. Beachten Sie die deutliche Aufweitung der Interzellularspalten durch polymorphkernige Leukozyten (PMN), die vom Bindegewebe in Richtung Sulkus (in Richtung Bildoberrand) wandern. Aus dem Bindegewebe stammendes Serumexsudat fließt ebenfalls durch die vergrößerten Interzellularspalten in Richtung Sulkus. Die Interzellularspalten erweitern sich zum einen durch das Aufbrechen der desmosomalen Verbindungen und zum andern durch einwandernde Entzündungszellen und Flüssigkeit.

Abb. 23: Die in beide
Richtungen zeigenden Pfeile verdeutlichen, dass das Saumepithel (JE) der
durchlässigste Anteil des gingivalen Epithels ist. Lösliche Substanzen können
von der Mundhöhle in das darunterliegende gingivale Bindegewebe (CT)
diffundieren, wohingegen Flüssigkeiten und Zellen aus dem Bindegewebe das Saumepithel
in Richtung gingivaler Sulkus (S) auf ihrem Weg in die Mundhöhle
passieren können. Aufgrund der Durchlässigkeit für bakterielle Produkte und
verschiedene Antigene aus der Mundhöhle weist das dem Saumepithel benachbarte
Bindegewebe häufig eine Infiltration mit chronischen Entzündungszellen, vorrangig
Lymphozyten und Plasmazellen, auf. OE, orales Gingivaepithel; SE, orales
Sulkusepithel
Abb. 24: Schematische Abbildung eines mesiodistalen Schnitts
durch die interdentale Gingiva. Diese
Zeichnung korrespondiert mit einem in Abb. 8 B gezeigten
Querschnitt der interdentalen Gingiva. Das Saumepithel (JE) bildet einen Kragen um jeden der
beiden benachbarten Zähne. Die Saumepithelien der benachbarten Zähne vereinigen
sich im am weitesten koronal gelegenen Anteil des Interdentalraums, nahe dem
interdentalen Zahnfleischrand (GM) oder „Col". Der aufgrund der histologischen
Bearbeitung verloren gegangene Zahnschmelz hinterlässt einen Schmelzraum (ES). AB,
Knochen des Alveolarfortsatzes; AC, Alveolarknochenkamm; CE, Zement; CEJ,
Schmelzzementgrenze; GF, Gingivafasern im Querschnitt; PDL, Desmodont; TF, transseptale Fasergruppe