Kongresse
5th Conference on 3D Printing in Surgery
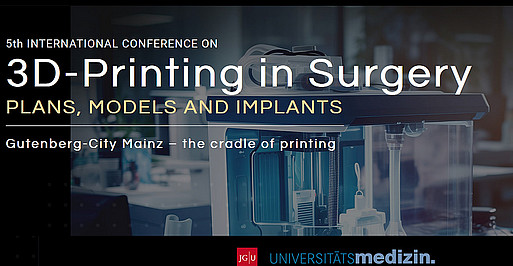
Vom Labor ins Weltall und in die Klinik: 3D-Druck in der Chirurgie
Fünfte internationale Konferenz an der Universitätsmedizin Mainz
Wo könnte ein 3D-Druck-Kongress besser stattfinden als in Mainz, der historischen Wiege des Buchdrucks? Im Oktober begrüßten die Kongresspräsidenten der Universitätsmedizin Mainz Professor Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, plastische Operationen, und Professor Dr. Erol Gercek, Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, ein internationales Fachpublikum mit rund 90 Teilnehmenden zum Austausch über die neuesten Erkenntnisse zum 3D-Druck in der Chirurgie. „Das Besondere an diesem Kongress ist, dass verschiedenste Disziplinen der Chirurgie und der Materialforschung zusammenkommen und voneinander lernen“, findet Gercek. Al-Nawas ergänzt: „Die Erforschung von druckbaren Biomaterialien findet oft isoliert vom klinischen Alltag statt. Der Kongress bietet Inspiration für Kooperationen zwischen Labor und Klinik, die es ermöglichen, diese neuen Methoden schneller für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen.“ Initiiert wurde der Kongress vom interdisziplinären Forschungsschwerpunkt BiomaTiCS – Biomaterials, Tissues and Cells in Science.
Vom Labor in die Schwerelosigkeit
Hauptthema des Kongresses, der unter dem Titel „Plans, Models and Implants“ stattfand, war die translationale Forschung. „Die Überführung von 3D-Druck Materialien und Technologien in die Klinik stellt aktuell die größte Herausforderung dar,“ so Professor Dr. Michael Gelinsky, Leiter des Zentrums für Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung der TU Dresden und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), der den Eröffnungsvortrag hielt.
Dazu nahm er die Teilnehmenden zunächst mit in die Schwerelosigkeit und zeigte, wie 3D-Druck auch auf einer Raumstation zur Behandlung von Astronautinnen und Astronauten eingesetzt werden könnte. Dr. Parth Chansoria aus Zürich stellte ein gemeinsames Projekt beider Arbeitsgruppen vor, bei dem kleine Muskelkonstrukte sehr schnell gedruckt werden können. Die neue Technologie mit eigens entwickelten Materialien wurde in einem spektakulären Parabelflug unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit getestet.
Von der Schwerelosigkeit in die Klinik
Doch muss es nicht gleich der Weltraum sein. Im Hinblick auf die Übertragung in die Klinik betonte Gelinsky: „Wir sollten nicht immer die kompliziertesten Lösungen anstreben, wie ein komplett gedrucktes Gewebe oder Implantat. Schon einfache 3D-Druck-Anwendungen können klinisch für die Diagnostik oder die Ermittlung des für eine Erkrankung besten Medikaments nutzbringend eingesetzt werden.“
Mehr Beispiele für bereits reale Anwendungen erbrachten weitere Referentinnen und Referenten: So können Chirurginnen und Chirurgen 3D-gedruckte Modelle der Aorta nutzen, um Operationen besser zu planen und zu üben, wie Professor Dr. Bernhard Dorweiler von der Universitätsmedizin Köln zeigte. Professorin Dr. Petra Mela und ihr Team von der TU München entwickeln Gerüste für Herzklappen mittels des Melt Electrowriting-Verfahrens, die die eigene Gewebebildung anregen. Auf lange Sicht soll es so möglich sein, dass Herzklappenimplantate bei Kindern mitwachsen.
Im medizinischen Bereich wird 3D-Druck seit Langem zur Herstellung anatomischer Modelle und Bohrschablonen verwendet. Die Technologie bietet jedoch auch Vorteile bei komplexeren Fällen der Knochenrekonstruktion. Dr. Dr. Neha Sharma, stellvertretende Leiterin des 3D-Drucklabors am Universitätsspital Basel, präsentierte sogar eine erfolgreiche Schädelrekonstruktion mithilfe eines hausintern 3D-gedruckten PEEK-Implantats, das den Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) entspricht, sowie weitere Anwendungen des Materials in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.
Fokus Biomaterialien
Ein Knackpunkt der Forschung sind die Biomaterialien und Druckverfahren. Das Team des Mainzer Forschungsschwerpunkts BiomaTiCS arbeitet daher unter anderem eng mit dem Max-Planck-Institut für Polymerforschung zusammen. Dr. Maria Villiou, Leiterin der Biofabrication and Biomaterials Innovation Group, stellte den Ansatz der Arbeitsgruppe vor: „Unser Ziel ist es, das Gebiet des Tissue Engineering voranzutreiben, indem wir fortschrittliche multifunktionale Biomaterialien zusammen mit verschiedenen Zelltypen und künstlichen Zellen verwenden. So möchten wir präzise zelluläre Reaktionen hervorrufen und Systeme mit bioinstruktiven Eigenschaften entwickeln.“ Alessia Longoni von der UCM Utrecht betonte die Bedeutung eines multidisziplinären Ansatzes bei der Entwicklung neuer druckbarer Bio-Tinten und 3D-Gewebemodelle.
Regulatorische Hürden
Doch auch wenn 3D-Druck in der Forschung funktioniert – die regulatorischen Anforderungen sind mit der neuen europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) gestiegen, was die klinische Anwendung hinauszögern kann. „Be aware of regulation“ lautete die zentrale Botschaft von Rechtsanwalt Professor Dr. Ulrich M. Gassner, Experte für Medizinprodukterecht. Er gab den Teilnehmenden praxisnahe Tipps an die Hand, wie sie durch das regulatorische Geflecht navigieren können. Bei 3D-Druck-Produkten müsse sorgfältig überprüft werden, ob sie z. B. unter die sogenannten personalisierten Medizinprodukte fallen. Je nach Anwendungsgebiet bestehen dann unterschiedliche Anforderungen und Zertifizierungsbedarfe.
Der Mainzer 3D-Druck Kongress kann auf eine lange Tradition zurückblicken – nach einer coronabedingten Pause ist es in diesem Jahr bereits die 5. Ausgabe des internationalen Kongresses. Nach dem gelungenen Neustart sind sich die Kongresspräsidenten einig, dass die Veranstaltung sicherlich bald eine Fortsetzung erfahren wird.
Weitere Informationen:
www.3dprint-congress.com/

Dr. Alessia Longoni, UMC Utrecht, Dr. Parth Chansoria, ETH Zürich, Dr. Dr. Neha Sharma, Universitätsspital Basel, Prof. i.R. Dr. Ulrich M. Gassner, Universität Augsburg, Prof. Dr. Erol Gercek und Prof. Dr. Ulrike Ritz, Direktor und Forschungsleiterin des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz, Prof. Dr. Petra Mela, TU München, Dr. Maria Villiou, Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz, Prof. Dr. Michael Gelinsky, TU Dresden, Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, plastische Operationen Universitätsmedizin Mainz; zugeschaltet: Prof. Dr. Bernhard Dorweiler, Universitätsmedizin Köln