Patientenversorgung
Grundlage für die Versorgung chronischer Schmerzpatienten ist heute ein bio-psycho-soziales Schmerzverständnis. Dieses bedingt enge interdisziplinäre Kooperationsstrukturen, da die Diagnosesicherung durch monodisziplinäre Abklärungen meist nicht möglich ist. Eine psychosomatische Abklärung als ultima ratio ist bei chronischen Schmerzpatienten aufgrund der engen Verschränkung von Schmerz und Affekt nicht sinnvoll. Simultandiagnostik und ggf. auch -therapie sind inhaltlich und organisatorisch zu gewährleisten.
Seit nunmehr rund 20 Jahren bestehen am Mainzer Universitätsklinikum solche interdisziplinären Kooperationsstrukturen in Diagnostik und Behandlung chronischer Schmerzpatienten. Wesentlich getragen werden sie vom Bereich Schmerztherapie (Schmerzambulanz) der Klinik für Anästhesiologie, der Neurologischen Klinik, der Psychosomatischen Klinik, der Orthopädischen Klinik, der Schmerzsprechstunde der Zahnklinik sowie der Rheumaambulanz der I. Med. Klinik. Grundprinzip ist dabei, dass dem Patienten nicht vorschnell fachspezifische Auffälligkeiten bzw. Befunde als bedeutsam für seine Schmerzen vermittelt werden, sondern die fachspezifisch erhobenen Befunde im Rahmen regelmäßiger interdisziplinärer Fallbesprechungen gewichtet und daraus ein Gesamtbehandlungskonzept entwickelt wird. Dies betrifft auch die rege Konsiltätigkeit der Schmerzambulanz bei stationären Patienten, die zusätzlich chronische tumor- oder nicht-tumorbedingte Schmerzen haben.
Bei den nicht-tumorbedingten chronischen Schmerzzuständen können fünf nosologische Subgruppen differenziert werden:
- nozizeptiv bzw. neuropathisch determinierte Schmerzzustände (z.B. rheumatische Arthritis, Phantomschmerz, komplexes regionales Schmerzsyndrom der Extremitäten bzw. M. Sudeck)
- nozizeptiv oder neuropathisch determinierte Schmerzzustände mit zusätzlich inadäquaten Schmerzbewältigungsstrategien (z.B. Katastrophisieren, fatalistisches Resignieren, sekundärer Krankheitsgewinn)
- nozizeptive bzw. neuropathische Schmerzsyndrome und gleichzeitig bestehende psychische Komorbidität (z.B. depressive und Angsterkrankung, Persönlichkeitsstörung, Sucht)
- dysfunktionale Schmerzzustände (z.B. Migräne, orofaciales Schmerzdysfunktionssyndrom, Lumboischialgie)
- psychische Erkrankungen mit Leitsymptom Schmerz (z.B. somatoforme Schmerzstörung).
Die häufigste psychische Erkrankung mit Leitsymptom Schmerz ist die somatoforme Schmerzstörung. Bei dieser Erkrankung gilt die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie bundesweit als das Kompetenzzentrum mit entsprechenden Patientenzuweisungen aus ganz Deutschland. Für die Behandlung dieser Patientengruppe besteht auch eine KV-Ermächtigung an der Klinik für Psychosomatische Medizin (trotz Zulassungssperre für Psychotherapeuten in Rheinhessen!). Um die gut funktionierende interdisziplinäre Kooperation noch engmaschiger zu strukturieren, werden z.Zt. (unter Federführung von Prof. Jage/Anästhesiologie und Prof. Egle/Psychosomatik) für die folgenden acht chronischen Schmerzsyndrome diagnostische und therapeutische Algorithmen entwickelt:
- Tumorschmerz
- chronischer LWS-Schmerz
- chronischer HWS-Schmerz
- chronischer Extremitätenschmerz
- primärer Kopfschmerz/chronischer Gesichtsschmerz
- chronisch viszerale Schmerzen
- neuropathischer Schmerz
- psychische Erkrankungen mit Leitsymptom Schmerz
Exemplarisch wurde dies für das chronische LWS-Schmerzsyndrom schon entwickelt (vgl. Abb. 1 und Tab. 1).
Abb. 1: Diagnostischer und therapeutischer Algorithmus bei LWS-Schmerz
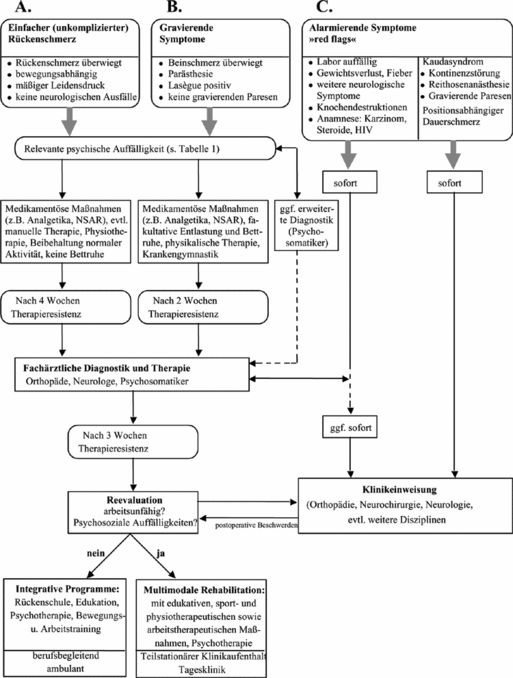
- Biologische
- Relativ niedriges (< 35 J.) und höheres Alter
- Degenerative Prozesse
- (Mikro)Traumen
- Schwere Arbeit (Tragen, Heben schwerer Lasten)
- Monotone Körperhaltung
- Vibrationsexposition
- Geringe berufliche Qualifikation
- Berufliche Unzufriedenheit
- Psychosoziale Überforderung („Stress“)
- Emotionale Beeinträchtigung (Depression, Angst)
- Somatisierungsneigung
- Passive Grundeinstellung
- Inadäquate Krankheitsmodellvorstellungen und Behandlungserwartungen
- Häufig wechselnde Behandler
- sekundärer Krankheitsgewinn
- Rauchen
- Übergewicht
- Geringe körperliche Kondition
- Mangelhafte Berücksichtigung der multikausalen Genese
- Invasive Eingriffe aufgrund Drängen/subjektivem Leidensdruck des Patienten
Berufliche
Psychische
Lebensstil
Iatrogene
Dies gilt auch für die postoperative Schmerztherapie in den verschiedenen chirurgischen Fachdisziplinen. Seit Jahren bestehen beispielhafte interdisziplinäre Kooperationen zwischen dem Bereich Schmerztherapie (Akutschmerzdienst) der Anästhesiologie und einigen chirurgischen Fachdisziplinen, überwiegend der Urologie, Gynäkologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie. Patienten mit starken postoperativen Schmerzen werden mittels besonders wirksamer Verfahren nach Standards behandelt - im Jahr sind es über 2000 Patienten, d.h. etwa 10% aller operierter Patienten. Schwerpunkte sind die Besonderheiten der postoperativen Analgesie bei Patienten mit chronischen Schmerzen. Darüber hinaus werden gegenwärtig gemeinsam mit den Fachdisziplinen therapeutische Algorithmen erarbeitet, um die Schmerzen aller operierter Patienten ausreichend zu behandeln. Epidemiologische Literaturdaten belegen, dass bei einem erheblichen Teil operierter Patienten unzureichend behandelte Operationsschmerzen chronifizieren können. Ein fachübergreifender Qualitätszirkel zur postoperativen Schmerztherapie soll für zukünftige Zertifizierungen Grundlagen schaffen.
Aufbauend auf der bisher überwiegend fachspezifischen Versorgung der überwiegenden Zahl von Patienten in den Universitätskliniken sowie den langjährigen Erfahrungen verschiedener Kernfächer (Anästhesiologie, Psychosomatik, Neurologie, Orthopädie) mit besonderen Schmerzpatienten soll die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch enger vernetzt werden, auch unter Integration z.B. der Inneren Medizin, Gynäkologie und anderer klinischer Fächer.
Folgende weiter reichende Versorgungsstrukturen für Patienten mit chronischen tumor- und nicht-tumorbedingten Schmerzen sind geplant:
- Konzentration von Diagnostik und Therapie chronischer Schmerzen in einem Interdisziplinären Schmerzzentrum (IST) durch eine örtlich zusammenhängende und personell konstante Kooperation der Kernfächer. Dies führt zu einer erheblichen zeitlichen Verkürzung diagnostischer/therapeutischer Wege der aus den verschiedenen Polikliniken zugewiesenen Patienten sowie zu einer effektiveren ärztlichen Arbeit. Das therapeutische Angebot im ambulanten, vor allem aber auch im stationären Bereich wird noch stärker fachübergreifend verzahnt. Dazu würde auch die fachübergreifende Strukturierung der postoperativen Schmerztherapie für alle operativen Fachdisziplinen der Universitäsklinik gehören, die keinesfalls isoliert von chronischen Schmerzzuständen gesehen werden sollte. Dadurch wäre eine beispielhafte ärztliche Weiterbildung bis zum Erwerb der Zusatzbezeichnung "Spezielle Schmerztherapie" für alle interessierten Fächer gesichert. Ausserdem kann angesichts der interdisziplinären Kompetenz des IST die dringlich nötige Verzahnung der klinischen mit der ambulanten Versorgung der Schmerzpatienten verbessert werden.
- Schaffung eines innerklinischen Palliativmedizinischen Konsildienstes, basierend auf der mehrjährigen Kooperation von Innerer Medizin (Hämatologie), Anästhesiologie und Psychosomatik. Dies bedeutet eine besondere Fürsorge der Patienten mit unheilbaren Erkrankungen am Ende ihres Lebens, die stationär in verschiedenen Einrichtungen der Universitätsklinik aufgenommen wurden und die möglicherweise wieder nach Hause entlassen werden sollen. Schwerpunkte sind Schmerztherapie, Symptomkontrolle, vor allem aber eine angemessene psychosoziale Begleitung der Betroffenen und ihrer nächsten Angehörigen. Die Ausgangssituation dieser Patienten ist in der Universitätsmedizin zur Zeit unzureichend geregelt, unter anderem auch deswegen, weil deren Zentrierung auf einer Palliativstation aus räumlichen Gründen nicht möglich ist. Aktuelle ethische Gesichtspunkte machen den geplanten Schritt eines solchen Konsildienstes dringlich.