Kollegiat:innen des Forschungskollegs
Mit Dr. Michael Kloth (Pathologie), Dr. Lea Sophie Penzkofer (Chirurgie) und Dr. Fabian Stöhr (Radiologie) starteten im Januar 2020 die ersten drei Clinician Scientists im Else Kröner-Forschungskolleg - und beendeten ihr Fellowship zum Dezember 2022.
Sieben weitere Kollegiat:innen schlossen sich in 2021 für die nächsten drei Jahre an: Dr. Simon J. Gairing, Dr. Maurice Michel, Dr. Kateryna Shmanko und Dr. Eva Maria Schleicher aus der I. Medizinischen Klinik; Dr. Tiemo Gerber und Dr. Dirk Ridder aus dem Institut für Pathologie sowie Dr. Lukas Müller (Radiologie).
Im Rahmen der zweiten Förderperiode starteten Dr. Andreas Kommer, Dr. Wolfgang Maximilian Kremer und Dr. Paul Steiner aus der I. Medizinischen Klinik in 2023 ihr Fellowship. Dr. Paula M. Bark (I. Medizinische Klinik), Dr. Ann-Kathrin Lederer (Chirurgie), Dr. Maximilian Moos (Radiologie) sowie Leon Mattern (I. Medizinische Klinik) schlossen sich in 2024 an. Das Kolleg komplementierten ab Januar 2025 Dr. Charlotte Claßen und Dr. Lucas Wiesmann aus der I. Medizinischen Klinik sowie Dr. Constantin Scholz (Chirurgie).

Ziel der Forschungsarbeit von Dr. Andreas Kommer ist es anhand von Registerdaten und histopathologischen Proben Risikofaktoren, Pathomechanismen und Prognosekriterien für das Immuncheckpoint-Inhibitor assoziierte Nierenversagen bei Patient:innen mit Lebertumoren zu erarbeiten. Anschließend sollen die Erkenntnisse prospektiv verifiziert und ein Diagnose- und Behandlungsalgorithmus erarbeitet werden. In einem weiteren Projekt soll die Effektivität der Peritonealdialyse im Vergleich zur Hämodialyse bei Patient:innen mit hepatorenalem Syndrom untersucht werden.

Die Forschungsarbeit von Dr. Wolfgang Maximilian Kremer (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) beschäftigt sich mit der sonographischen und serologischen Messung von Sarkopenie als Einflussfaktor auf den Verlauf von hepato-onkologischen Erkrankungen. Ziel ist es, durch eine gezielte, patientenorientierte Intervention die Prognose und das Outcome von Patient:innnen zu verbessern.

Ziel der Forschungsarbeit von Dr. Paul Steiner (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) ist es, die Auswirkungen eines gesunden Lebensstils, also insbesondere körperliche Fitness und gesunde Ernährung, auf die Rezidivwahrscheinlichkeit und die Lebensqualität nach kolorektalem Karzinom mit Lebermetastasen zu untersuchen. Die Hypothese ist, dass Karzinome und deren Rezidive durch eine Alterung des Immunsystems entstehen und diese Alterung durch körperliche Aktivität umkehrbar ist. Während zunächst retrospektiv die bereits therapierten Patient:innen innerhalb der Universitätsmedizin Mainz untersucht werden, soll diese Arbeit in enger Zusammenarbeit mit den KollegInnen der Sportmedizin die Vorbereitung für eine prospektive randomisierte Interventionsstudie sein.

Das Forschungsprojekt von Dr. Paula M. Bark (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) hat zum Ziel, T-Zell-Subpopulationen im Blut von Patient:innen mit inoperablem Leberzellkarzinom (HCC), die einer Immuntherapie unterzogen werden, zu untersuchen. T-Zellen spielen eine entscheidende Rolle im Rahmen der angeborenen Immunantwort und scheinen maßgeblich an der individuell schwer vorhersagbaren Wirkung der Immuntherapeutika auf die Tumorerkrankung beteiligt zu sein. Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, die Rolle spezifischer T-Zell-Typen im Zusammenhang mit dem Therapieansprechen und dem Gesamtüberleben der Patient:innen besser zu verstehen. Zudem sollen jene T-Zellen anhand ihrer Marker im Blut identifiziert werden, die einen Einfluss auf das Therapieansprechen und Überleben der Patient:innen nehmen. Eine Charakterisierung der T-Zell-Untergruppen könnte es ermöglichen, mittels einer Blutuntersuchung Vorhersagen darüber zu treffen, welche der zugelassenen Immuntherapien für den jeweiligen Betroffenen/die Betroffene am erfolgversprechendsten ist. Dies würde die Therapieentscheidung präzisieren und personalisieren, was einen bedeutenden Fortschritt in der individualisierten Krebstherapie darstellen könnte.

Ziel der Forschungsarbeit von Dr. Ann-Kathrin Lederer (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie) ist es zu untersuchen, inwieweit sich körpereigene Darmbakterien, von denen anzunehmen ist, dass sie in engem Kontakt zur Leber und den Gallenwegen stehen, auf das Tumorwachstum des Gallengangskrebs auswirken. Für das Projekt werden aus Gewebeproben 3D-Modelle des Tumors, sogenannte Organoide, gezüchtet, die anschließend mit Bestandteilen von Bakterien und Pilzen behandelt werden können.

Die Forschungsarbeit von Dr. Maximilian Moos (Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie) beschäftigt sich mit der Entwicklung von bildmorphologischen Prognosefaktoren von Kolorektalen Lebermetastasen anhand von CT- und MRT- Bildern. Ziel des Projekts ist es, anhand dieser Prognosefaktoren die interdisziplinäre Therapie der Patienten zu optimieren.

Die Forschungsarbeit von Leon Mattern (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) untersucht, wie Patient:Innen mit Leberkrebs und die jeweiligen Ärzt:Innen die Prognose einschätzen. Da eine übereinstimmende Erwartung zur Prognose essentiell ist, um gemeinsam eine informierte Entscheidung zur weiteren Therapie zu treffen, sollen Leberkrebspatient:Innen in allen Erkrankungsstadien zu ihrer Einschätzung zur eigenen Lebensqualität, ihrer Lebenserwartung und potentieller Therapieaussichten befragt werden. Die gleichen Fragen werden von den behandelnden Ärzt:Innen bearbeitet und die Antworten verglichen. Ziel der Forschungsarbeit ist es herauszufinden, ob die Einschätzungen von Patient:Innen und Behandler:Innen übereinstimmen und wie genau die jeweiligen Prognosen in der Realität eintreten. Hierdurch sollen Probleme in der Kommunikation zwischen Leberkrebspatient:Innen und Ärzt:Innen aufgedeckt werden, damit diese in einem zweiten Schritt verbessert werden kann.

In der Forschungsarbeit von Dr. Charlotte Claßen (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) soll der Einfluss einer bestehenden chronischen Nierenkrankheit (CKD) auf die Prognose sowie Wahl und Limitation der Therapie bei Patient:innen mit hepatozellulärem Karzinom (HCC) untersucht werden. CKD ist mit einem erhöhten Krebsrisiko und einem schlechteren Outcome assoziiert. Dieser Zusammenhang soll anhand von Daten aus der Gutenberg-Gesundheitsstudie und eines Registers Mainzer HCC-Patienten analysiert werden. Darüber hinaus sollen ursächliche Pathomechanismen experimentell untersucht werden.

Die Forschungsarbeit von Dr. Constantin Scholz (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie) untersucht den Einfluss von verzweigtkettigen Aminosäuren auf die Leberregeneration nach ausgedehnten Leberresektionen: Bei bösartigen Lebertumoren bietet die chirurgische Resektion häufig die einzige Heilungschance. Um eine vollständige Entfernung großer Tumoren zu gewährleisten, ist häufig die Resektion eines erheblichen Anteils des Lebergewebes notwendig. Nach der Operation ist die Proteinsyntheseleistung der Leber oft eingeschränkt, was zur Bildung von Aszites und Pleuraergüssen führen kann.
Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob die Leberregeneration nach einer Leberresektion durch die Gabe von verzweigtkettigen Aminosäuren verbessert werden kann. Hierfür wird eine randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, in der Patient:innen mit Lebertumoren im perioperativen Zeitraum Eiweißprodukte als Trinknahrung erhalten. Mittels Leberfunktionstests wird die Leberfunktion sowohl vor als auch nach der Operation gemessen.

Das Forschungsprojekt von Dr. Lucas Wiesmann (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) beschäftigt sich mit dem komplementären Einsatz von Fucoidan im Rahmen der primären Immuntherapie bei Patient:innen mit einem inoperablen Leberzellkarzinom (HCC). Fucoidan ist eine natürliche Verbindung, die unter anderem in verschiedenen Arten von Braunalgen vorkommt und im asiatischen Raum ein häufig angewendetes Nahrungsergänzungsmittel ist. In einigen wissenschaftlichen Publikationen konnte ein positiver Effekt in der Tumortherapie nachgewiesen werden. Um dies zu überprüfen, soll eine klinische Studie mit translationalen Aspekten durchgeführt werden. Anhand verschiedener Experimente sowie der Bestimmung von Biomarkern im Blut und durch klinische und radiologische Untersuchungen sollen der Wirkmechanismus und die Wirksamkeit untersucht werden. Ziel ist es, den Patient:innen neben der Standardtherapie eine wissenschaftlich untersuchte komplementäre Therapie zur Unterstützung der etablierten Standardtherapie anzubieten.
Alumni seit 2024

Dr. Eva Maria Schleicher beschäftigt sich mit der Interaktion von Leber und Niere hinsichtlich einer häufigen Komplikation bei Patient:innen mit HCC und Leberzirrhose - der akuten Nierenschädigung. Anhand des bereits sehr gut etablierten HCC-Registers werden zunächst vorhandene Daten hinsichtlich akuter Nierenschädigungen untersucht. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, ob und wann eine Nierenersatztherapie sinnvoll sein kann und welcher prognostische Einfluss auf das Gesamtüberleben und Management von bereits systemtherapierten Patientinnen mit HCC und Leberzirrhose abgeleitet werden kann. Mithilfe von experimentellen und klinischen Untersuchungen von Biomarkern im Urin und Blut soll ein allgemeingültiger Ansatz zum klinischen Management von akuten Nierenschädigungen und Unterschiede in deren Ätiologie erforscht werden. Diese Erkenntnisse sollen im besten Fall eine neue Therapieoption nach sich ziehen.
>> Vorstellung der Kollegiatin [08/2021](MP4 121,5 MB)

Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit von Dr. Simon J. Gairing (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) liegt auf der Identifizierung von immunologischen Biomarkern zur Vorhersage des Ansprechens auf eine Immuntherapie von Patienten mit inoperablem Leberkrebs (Hepatozelluläres Karzinom). Ziel ist es, anhand von Transkriptom- und Mutanom-Analysen Biomarker-basierte Algorithmen zur besseren Risiko-Abschätzung von Patient:innen mit inoperablem Leberkrebs zu etablieren.
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 111,7 MB)

Die Forschungsarbeit von Dr. Dr. Lukas Müller (Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie) zielt darauf ab, die prognostische Rolle der "Body Composition"-Parameter (Muskelmasse, viszerales Fettgewebe, subkutanes Fettgewebe etc.) für Patient:innen mit Leberkrebs zu untersuchen und die quantitative Erfassung dieser Parameter zu standardisieren. Grundlage hierfür soll die Etablierung einer KI-basierten, automatisierten Detektion anhand von radiologischen Bilddatensätzen sein.
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 121,4 MB)
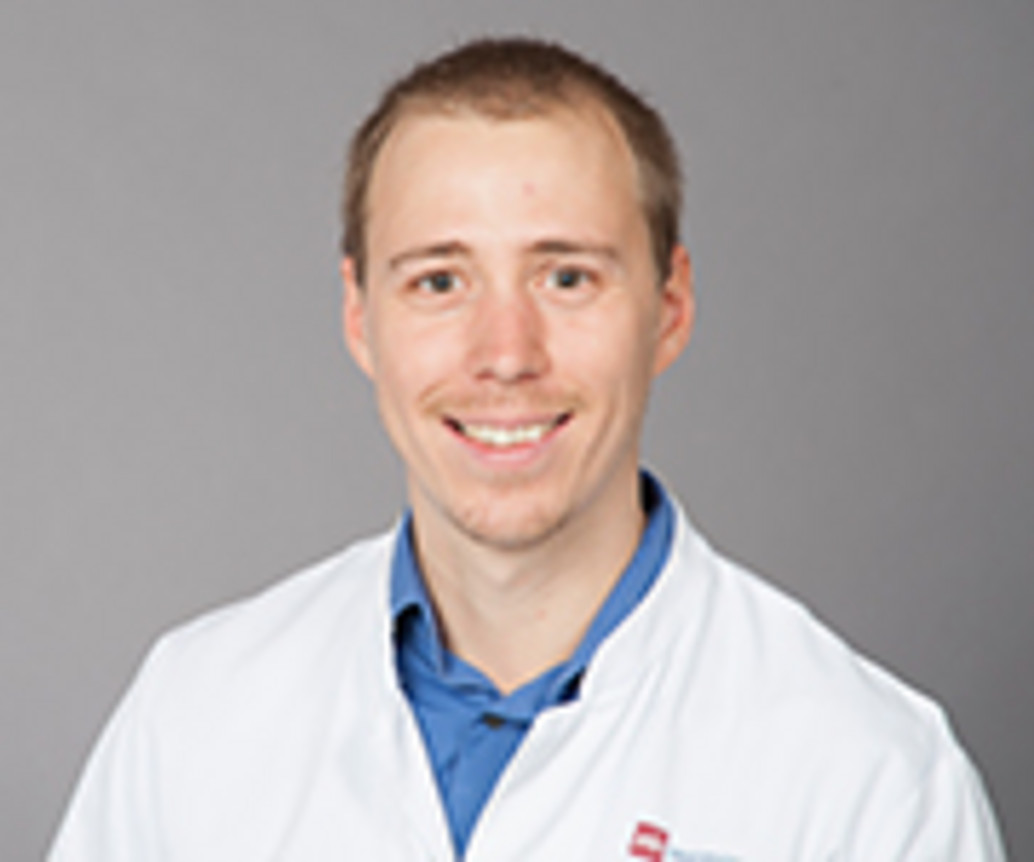
Im Fokus der Forschungsarbeit von Dr. Tiemo Gerber (Institut für Pathologie) stehen Zell-Zell-Verbindungen von Gallengangskarzinomen. Dafür wird ein umfassendes Kollektiv von Gewebeproben erstellt (sogenannter Tissue-Microarray) und die Zell-Verbindungsproteine E- und N-Cadherin vergleichend mit anderen Biomarkern immunhistochemisch dargestellt. Diese Analysen könnten die feingewebliche Unterscheidung zwischen primär in der Leber entstandenen Gallengangskarzinomen und Metastasen anderer Tumoren verbessern. Ferner soll die Rolle der Zell-Zell-Verbindungen hinsichtlich der Progression, also der Invasion und Metastasierung, von malignen Tumoren weiter aufgeklärt werden.
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 93,1 MB)

Die Forschung von Dr. Maurice Michel (I. Medizinische Klinik und Poliklinik)) konzentriert sich auf die Evaluation Tumormetabolismus-assoziierter Signalwege als neue Biomarker in der Diagnostik und Therapie hepatobiliärer Tumore, insbesondere des Gallengangskarzinoms (Cholangiozelluläres Karzinom). Ziel ist es, den Einfluss von Stoffwechselwegen auf die Immunantwort von Immuncheckpoint-Inhibitoren zu untersuchen und die Entstehung von Resistenzmechanismen gegenüber systemischer Therapie zu analysieren.
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 105,1 MB)

In der Forschungsarbeit von Dr. Kateryna Shmanko (I. Medizinische Klinik und Poliklinik) wird der Frage nachgegangen, welche Mechanismen hinter dem schlechten Überleben der Patienten mit einem Leberzellkrebs (hepatozelluläres Karzinom, HCC) und maligner Pfortaderinfiltration (PVTT) stehen. Vom besonderen Interesse ist die Korrelation zwischen dem Grad der Pfortadertumorinfiltration, der Therapie und dem Überleben bei Patient:innen mit einem HCC. Es soll retrospektiv untersucht werden, von welcher Therapie die Patienten in Abhängigkeit vom Ausmaß der Infiltration profitiert haben. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zum besseren Verständnis der Ursachen der schlechteren Prognose der Patienten mit HCC und PVTT sowie zu individualisierten Therapieentscheidungen unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Pfortadertumorinfiltration beitragen.
>> Vorstellung der Kollegiatin [08/2021](MP4 102,1 MB)
Alumni seit 2023

Die Forschungsarbeit von Dr. Michael Kloth (Institut für Pathologie) beschäftigt sich mit der Charakterisierung von kolorektalen Lebermetastasen und deren häufig auftretenden Therapieresistenz. Seine Analysen während des Fellowships haben zu einer multimodalen Charakterisierung des klinischen Einflusses von Therapie-assoziierten immunologischen Veränderungen in kolorektalen Lebermetastasen geführt (vgl. Ulmer B et. al., NPJ Syst Biol Appl. 2022; Lang H et. al., Ann Transl Med. 2021; Lang H et. al., Ann Surg. 2021 und Lang H et. al., Ann Surg. 2019).
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 80,5 MB)

Die Forschungsarbeit von Dr. Lea Penzkofer (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie) beschäftigt sich mit der Etablierung neuer Grenzen und Prognosemarker bei der chirurgischen Therapie des hepatozellulären Karzinoms (HCC). Die Ergebnisse einer Auswertung zeigten, dass Resektionen in Leberzirrhose nach angemessener Patientenselektion und einer Begrenzung des Operationsumfangs sicher durchführbar sind (vgl. Penzkofer et. al., Zentralbl Chir, 2022). In einer Untersuchung zu HCC in Nicht-Zirrhose konnte nachgewiesen werden, dass die chirurgische Therapie auch bei ausgedehnten Tumoren mit einer vergleichsweise geringen postoperativen Mortalität und einem guten Langzeitüberleben einhergeht (vgl. Penzkofer et. al., J Clin Med, 2022).
Die sich in Arbeit befindenden Projekte sollen langfristig weitergeführt werden. Zudem sind bereits neue Projekte, die sich vermehrt auch auf die verschiedenen malignen Tumoren des hepatobiliären Formenkreises beziehen, in Planung.
>> Vorstellung der Kollegiatin [08/2021](MP4 119,8 MB)

Dr. Fabian Stöhr (Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie) analysierte bereits vielfach vorhandene CT- und MRI-Bilddaten von Leberzellkarzinomen mittels der neuartigen Radiomics-Methode. Anhand dieser Daten gelang es, ein Radiomics-Modell zur Vorhersage einer makrovaskulären Infiltration bei Patienten mit HCC zu entwickeln, um die Therapie in Zukunft individualisierter gestalten zu können (vgl. Stoehr F. et al., Cancers, 2022). Nach Abschluss dieses Projekts wird nun ein weiterer Fokus auf die Entwicklung, Implementation und Evaluation von sogenannten „Imaging Biomarkern“ gelegt. Somit soll eine Risikobewertung für Leberkrebspatient:inen entwickelt und deren Behandlungserfolg bewertet werden.
>> Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 106,0 MB)

Dr. Dirk Ridder (Institut für Pathologie) beschäftigte sich mit den molekularen Mechanismen, die zur Entwicklung chronisch-entzündlicher Prozesse in der Leber und zur Entstehung des hepatozellulären Karzinoms führen. An einem umfassenden, klinisch gut charakterisierten Patientenkollektiv wurden feingewebliche Untersuchungen durchgeführt, um die im Tumorgewebe und im angrenzenden Lebergewebe ablaufenden molekularen Prozesse genauer zu verstehen, neue prognostische Biomarker zu identifizieren und Ansatzpunkte für mögliche neue Therapien herauszuarbeiten. Die am menschlichen Gewebe erhobenen Befunde wurden mit unterschiedlichen molekularbiologischen Methoden und in Modellsystemen, wie z.B. Zellkulturen detailliert weiter untersucht.
Es konnte gezeigt werden, dass der Cyld-Tak1-Signalweg eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie des HCCs spielt (vgl. Ridder et al., Cancers, 2022). Desweiteren konnten immunhistochemisch weitere prognostische Faktoren im HCC identifiziert bzw. bestätigt werden (vgl. Ridder et al., Cancers, 2021 und Ridder et al., International Journal of Cancer, 2022).
→ Vorstellung des Kollegiaten [08/2021](MP4 90,1 MB)



